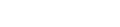AGES - Austrian Agency for Health and Food Safety
AGES - Austrian Agency for Health and Food Safety
05/23/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/24/2024 01:28
AGES-Radar für Infektionskrankheiten
AGES-Radar für Infektionskrankheiten - 23.05.2024
Zusammenfassung
Die Grippewelle der Saison 2023/24 ist zu Ende, auch COVID-19 und RSV werden kaum noch nachgewiesen. In dieser Ausgabe fassen wir die Saison der wichtigsten respiratorischen Infektionskrankheiten zusammen.
Der Masernausbruch in Österreich hält an, wenngleich die Aktivität in den letzten vier Wochen weiter zurückging. Seit der letzten Ausgabe des Radars sind 24 neue Erkrankungen im epidemiologischen Meldesystem erfasst worden. Mit Stand vom 21.05.2024 wurden für das laufende Jahr 425 Fälle gemeldet. Betroffen sind alle Bundesländer außer Kärnten.
Die Pertussisfälle in Europa und auch in Österreich nehmen weiterhin zu, eine Gesundheitsgefahr besteht besonders für die vulnerable Gruppe der Kleinkinder im Alter von 0 bis 6 Monaten.
Im Thema des Monats geht es um Campylobacter, dem häufigsten Auslöser von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen. Gerade in der Grillsaison können mit konsequenter Küchenhygiene Infektionen verhindert werden.
Zur aviären Influenza in den USA liefern Studien neue Erkenntnisse.
Situation in Österreich
In der zweiten Jahreshälfte 2023 kam es zu einem Anstieg der SARS-CoV-2-Viruslast im Abwassermonitoring, welcher in einem Allzeithoch Mitte Dezember gipfelte. Auf diesen Anstieg der SARS-CoV-2-Nachweise im Abwasser folgte eine rasante Abnahme. Ab Februar 2024 wurde das Virus nur noch in geringem Ausmaß nachgewiesen. Ein vergleichbarer Verlauf konnte in den stationären Krankenhausaufnahmen beobachtet werden: nach dem Höhepunkt Mitte Dezember mit 1.501 COVID-19-Aufnahmen auf Normalstationen, kam es innerhalb eines Monats zu einem Rückgang auf das Niveau von September 2023.
Von Herbst 2023 bis Frühling 2024 hat sich die Variante BA.2.86 durchgesetzt und macht seit Dezember 2023 die Mehrheit der von der AGES sequenzierten SARS-CoV-2-Proben in Österreich aus. Die sequenzierten Proben der letzten Wochen konnten ausschließlich der BA.2.86-Tochterlinie JN.1 zugeordnet werden. Allerdings wurden aufgrund der geringen Fallzahl zuletzt nur sehr wenige Proben genetisch analysiert.
Das diagnostische Influenzanetzwerk DINÖ verkündete Anfang April das Ende der saisonalen Grippewelle. Auch die geschätzte Anzahl von Influenza bzw. grippeähnlichen Erkrankungen ist wieder auf dem niedrigen Niveau des Saisonbeginns in Kalenderwoche 40 angelangt.
Im Vergleich zur Saison 2022/23 registrierte das DINÖ in der aktuellen Grippesaison 2023/24 eine geringere Anzahl an Influenzanachweisen. Am Höhepunkt Anfang Februar wurden ca. 650 Proben in einer Woche positiv auf Influenza getestet. In der Saison 2022/23 kam es bereits im Dezember zum Höhepunkt mit über 1.200 Influenza-positiven Proben in einer Woche.
Die Krankenhausaufnahmen haben in der ersten Februarwoche mit 631 Aufnahmen auf Normalstationen ihren Höhepunkt erreicht. In der ersten Maiwoche wurden nur noch neun Aufnahmen auf Normalstationen registriert.
Eine Influenza-B-Welle ist heuer ausgeblieben.
Seit Mitte April 2024 wurde im Sentinel-System des Österreichischen RSV-Netzwerks keine der Sentinel-Proben positiv auf das Respiratorische Synzytial-Virus getestet.
Die RSV-Welle hat in der aktuellen Saison 2023/24 später begonnen als im Vergleichsjahr 2022/23. Die Anzahl der laborchemisch bestätigten Fälle war mit knapp über 200 Nachweisen in einer Woche am Höhepunkt Ende Jänner 2024 ebenfalls geringer im Vergleich zu knapp 350 Nachweisen am Höhepunkt der Saison 2022/23.
Die Krankenhausaufnahmen erreichten Anfang Februar ihren Höhepunkt. Seit Mitte April wurden auf Intensivstationen keine RSV-bedingten Aufnahmen mehr verzeichnet (Stand: 22.05.2024).
Die Mehrheit der aufgenommenen Patient:innen waren Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahren.
Weiterführende Informationen zur RSV-Impfung finden Sie unter: Impfplan Österreich 2023/2024 (sozialministerium.at)
Mit Stand 21.05.2024 wurden in Österreich für das laufende Jahr 425 bestätigte Fälle gemeldet, im gesamten Jahr 2023 waren es 186.
Wer ist erkrankt?
Die höchsten Inzidenzraten finden sich bei Säuglingen und in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Die meisten Fälle wurden heuer bisher in Niederösterreich (105), Tirol (85), Wien (62) und der Steiermark (53) gemeldet. Im Jahr 2024 sind bisher 79 (18,9 %) der 418 Fälle, mit diesbezüglichen Angaben, als hospitalisiert eingetragen, vier davon auf der Intensivstation.
Von den 282 Fällen, bei denen eine Information zum Impfstatus vorliegt, waren 254 (90,1 %) ungeimpft, elf (3,9 %) hatten eine Postexpositionsimpfung erhalten, drei (1,1 %) Personen waren einmal und 14 (5 %) waren laut Dokumentation zweimal gegen Masern geimpft.
Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Infektionen zeichnen sich durch grippeartige Symptome mit hohem Fieber und einen charakteristischen Hautausschlag aus. Es können lebensbedrohliche Komplikationen wie Entzündungen der Lunge und des Gehirns auftreten.
Die Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) bietet einen langanhaltenden Schutz vor schweren Verläufen und Folgeerkrankungen. Versäumte Impfungen gegen Masern können und sollten in jedem Lebensalter so schnell wie möglich nachgeholt werden. Um Säuglinge zu schützen, die für die Impfung noch zu jung sind, jedoch ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf und Komplikationen einer Maserninfektion haben, ist es entscheidend, dass das gesamte Umfeld immun ist. Wenn ältere Geschwister zweimalig geimpft sind, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie das Virus, beispielsweise aus der Schule oder dem Kindergarten, mit nach Hause bringen.
Weiterführende Informationen zur Masern-Mumps-Röteln-Impfung finden Sie im Impfplan Österreich 2023/2024 (sozialministerium.at)
Internationale Ausbrüche
Die Übertragung von SARS-CoV-2 begann im Spätsommer anzusteigen, wobei ein deutlicher Anstieg bis zur Kalenderwoche 49 zu beobachten war. Danach verzeichnete die SARS-CoV-2-Aktivität wieder einen Rückgang. Derselbe Ablauf konnte bei den schweren COVID19-Erkrankungen beobachtet werden, die seit Kalenderwoche 50 einen stetigen Rückgang verzeichnen. COVID-19 betraf überwiegend Personen im Alter von 65 Jahren und darüber. Derzeit ist die Aktivität in den meisten EU/EWR-Ländern gering.
Im Verlauf der Saison 2023/24 haben sich BA.2.86 und vor allem deren Sublinie JN.1* durchgesetzt und XBB.1.5-Varianten verdrängt.
Ausführlichere Informationen zur internationalen und österreichischen Variantenlage finden Sie auf: Coronavirus - AGES
Mitte Dezember markierte den Beginn der saisonalen Grippewelle. Ab Ende Jänner 2024 war ein rückläufiger Trend der Influenzaaktivität zu beobachten. Im Vergleich zu den Trends vergangener Grippewellen ging die saisonale Influenzaaktivität in dieser Saison früher zurück. Schwere grippebedingte Erkrankungen betrafen alle Altersgruppen. Es wurden sowohl Influenza-Viren des Typs A als auch des Typs B nachgewiesen. Im ersten Teil der Saison dominierten die A(H1)pdm09-Viren, ab Ende März 2024 wurde die B/Victoria-Linie häufiger nachgewiesen, allerdings insgesamt in sehr geringem Ausmaß.
Die RSV-Aktivität begann im Oktober anzusteigen, und erreichte Mitte Dezember einen Höhepunkt. Die größten Auswirkungen hatte RSV auf Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren.
Communicable disease threats report, 28 April - 4 May 2024, week 18 (europa.eu)
Vom Jahr 2023 bis inklusive April 2024 hat sich die Zahl der Pertussisfälle im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 verzehnfacht: beinahe 60.000 Infektionen wurden im EU/EWR-Raum gemeldet.
Laut ECDC hat diese starke Zunahme mehrere Gründe: Pertussis tritt grundsätzlich in Wellen auf, mit Höhepunkten alle drei bis fünf Jahre; die COVID-19-Pandemie hatte durch die Infektionsschutzmaßnahmen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen, trug aber auch dazu bei, dass Impfprogramme nicht durchgeführt werden konnten.
Von schweren Verläufen sind hauptsächlich Kleinkinder unter sechs Monaten betroffen. In Großbritannien sind im Jahr 2024 bereits fünf Kinder gestorben. Ziel der Impfung ist bei Pertussis generell, diese vulnerable Gruppe zu schützen.
In Österreich wurden im Jahr 2024 bisher 4.943 Fälle gemeldet (Stand: 20.05.2024).
Die Impfung ist in Österreich im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Die Grundimmunisierung im Säuglingsalter soll im Schulalter aufgefrischt werden. Danach soll die Impfung auch im Erwachsenenalter regelmäßig aufgefrischt werden, damit der Impfschutz aufrecht bleibt. Die Pertussis-Impfung wird allen Personen empfohlen.
Um Säuglinge in den ersten Lebensmonaten zu schützen, wird insbesondere schwangeren Frauen im dritten Trimester die Impfung nahegelegt, unabhängig vom Abstand zur letzten Pertussis-Impfung.
Weiterführende Informationen zur Pertussis-Impfung finden Sie im Impfplan Österreich 2023/2024 (sozialministerium.at).
Aviäre Influenza in Milchkühen - USA
Mit Stand 22.05.2024 hat das US Department for Agriculture (USDA) 49 Hochpathogene-Aviäre-Influenza (HPAI)-Fälle bei Milchkühen in neun US-Bundesstaaten bestätigt. Seit Erscheinen der 8. Ausgabe des AGES-Radars für Infektionskrankheiten vom 25.04.2024, in dem wir im Thema des Monats auf Aviäre Influenza eingegangen sind, wurden 14 neue Fälle bei Kühen gemeldet, darunter auch erstmals zwei in Colorado.
Zudem wurde am 22.05.2024 der zweite humane aviäre-Influenza-Fall in den USA in Zusammenhang mit dem derzeitigen Ausbruch bei Milchkühen bestätigt. Es handelt sich dabei, wie beim ersten Fall, um einen Arbeiter eines Milchviehbetriebs, diesmal im Bundestaat Michigan. Ebenso wie beim ersten bestätigten Fall, hat der Patient eine Bindehautentzündung (Konjunktivitis).
Ein Anfang Mai veröffentlichter Bericht, u. a. von Forschern der USDA, zeigt auf, dass das Virus bereits seit Dezember 2023 in Kühen zirkuliert. Genomische Analysen und epidemiologische Untersuchungen weisen darauf hin, dass dem derzeitigen Ausbruch eine einzelne Übertragung von einem Wildvogel auf ein Rind zugrunde liegen dürfte. Der Übersprung auf Rinder wurde durch eine Vermischung bzw. Neuverteilung genetischer Information innerhalb der aviären Influenza-Virus-Stämme ermöglicht, in der Fachsprache "Reassortierungsereignis" genannt. Der Transport asymptomatischer Rinder durch die USA könnte anschließend eine Rolle bei der Ausbreitung des HPAI-Virus in den Milchviehbeständen des Landes gehabt haben.
Eine weitere Studie ergab, dass in den Milchdrüsen von Kühen sowohl aviäre als auch menschliche Influenza-A-Virusrezeptoren zu finden sind. Damit sind Kühe an dieser Stelle empfänglich für das Virus. Dies erklärt die hohen Mengen H5N1-Viren in der Milch infizierter Kühe. Durch die Kombination von aviären und menschlichen Influenza-A-Virusrezeptoren in ihren Milchdrüsen, hätten Milchkühe das Potential, als "Mischgefäß" für neue AI-Virus-Varianten zu fungieren.
Beide Studien müssen noch einer Bewertung durch unabhängige Gutachter:innen, den peer-reviewing process, durchlaufen.
Eine mögliche Infektion der Rinder mit dem HPAI-Virus durch die Verfütterung von Nebenprodukten aus der Geflügelhaltung (z.B. Einstreu, Kot, verstreutes Futter) wird ebenfalls diskutiert. Die American Feed Industry Association (AFIA) hat Anfang Mai dazu eine Stellungnahme abgegeben und diese Möglichkeit dementiert.
Derzeit schätzen US-amerikanische Gesundheitsbehörden das Risiko für die Allgemeinbevölkerung als gering ein (Stand 08.05.2024). Die Situation wird genau beobachtet, es werden Beprobungen entlang der Lebensmittelkette und Testungen von Rindern und Kontaktpersonen durchgeführt. In Proben pasteurisierter Milch aus dem Einzelhandel konnte das Virusgenom nachgewiesen werden. Infektiös sind die Viren nach der Pasteurisierung nicht mehr. FDA und CDC raten vom Verzehr von Rohmilch ab. Auch in Lungengewebe einer asymptomatischen Kuh aus einer betroffenen Herde konnte das HPAI-Virus nachgewiesen werden. In Fleischproben aus dem Handel wurde noch kein Virus nachgewiesen. Eine Studie der USDA zeigte, dass das Erhitzen von Fleisch auf 60 bis 70 Grad Celsius (145 bis 160 Grad Fahrenheit) das Virus abtötet.
In Europa gibt es keine Fälle von AI bei Rindern. Die Zahl der gemeldeten Ausbrüche bei Vögeln und Geflügel ist in Europa aktuell so gering wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Um Krankheitserreger generell zu reduzieren, wird empfohlen, sich an die grundlegenden Regeln der Küchenhygiene zu halten, Fleisch und Eier ausreichend zu erhitzen und keine Rohmilch zu verzehren: Sicher kochen - AGES
Weitere Informationen zur aviären Influenza in Österreich finden Sie im Tierseuchenradar.
H5N1 Bird Flu: Current Situation Summary | Avian Influenza (Flu) (cdc.gov)
Hepatitis E
Die WHO informiert in ihren "Disease Outbreak News" vom 08.05.2024 über einen Hepatitis-E-Ausbruch in der östlichen Provinz Ouaddai im Tschad, Zentralafrika. In die Provinz Ouaddai sind seit April 2023 zahlreiche Menschen aus dem Sudan geflohen. Zwischen 2. Jänner und 28. April 2024 wurden insgesamt 2.092 Verdachtsfälle von Hepatitis E gemeldet, darunter sieben Todesfälle. Die am stärksten betroffenen Altersgruppen sind 6 bis 17 Jahre (53,2 % aller Fälle) und 18 bis 59 Jahre (23,9 % aller Fälle). Die meisten Fälle werden aus dem André Bezirk gemeldet, in dem drei Flüchtlingslager und eine temporäre Flüchtlingsunterkunft aufgebaut wurden, die um die 300.000 Personen beherbergen. Begrenzter Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie unzureichende sanitäre Einrichtungen und Hygiene erhöhen das Risiko von Hepatitis-E-Ausbrüchen. Das Risiko wird von der WHO auf nationalem Level als hoch eingeschätzt, auf globaler Ebene als gering.
In Österreich ist die Situation mit dem derzeitigen Ausbruch im Tschad, bzw. schweren Ausbrüche in u.a. Südost- und Zentralasien, dem Mittleren Osten, sowie Mexiko, nicht vergleichbar. In Industrieländern, zu denen auch Österreich zählt, findet die Übertragung von Hepatitis E hauptsächlich über den Verzehr von nicht ausreichend durchgegartem Schweinefleisch oder Wildfleisch statt. In Europa wird Hepatitis E hauptsächlich vom Genotyp 3 verursacht, während in den afrikanischen Ländern Genotyp 1 und 2 vorherrschend sind. (RKI, Stand: 17.05.2024)
In Österreich wurden im Jahr 2023 63 Hepatitis-E-Fälle gemeldet, im Jahr 2024 wurden bisher 20 Fälle identifiziert (Stand: 21.05.2024).
Thema des Monats
Die Grillsaison ist eröffnet, bei Gas-, Kohle- und Holzflammen unterhalten sich die Gäste über Rezepte, das Wetter, andere Gäste und nicht selten über das Grillen selbst. Soll man Bier über das Fleisch schütten, grillen Profis nur mit Deckel und wie roh soll das Steak sein?
Lebensmittelhygiene schafft es nur selten auf die Liste angesagter Smalltalk-Themen. Dabei haben in der warmen Jahreszeit auch die lebensmittelbedingten Erkrankungen Hochsaison. Ein Mitgrund dafür sind Bakterien der Gattung Campylobacter. Sie zählen zu den wichtigsten Erregern von bakteriellen Darminfektionen beim Menschen und können leichte bis schwere Durchfallerkrankungen verursachen. Ihren Auftritt bei Grillpartys verdanken sie meist dem Geflügelfleisch. Jährlich kommt es in Österreich zu rund 6.000 gemeldeten Infektionen, im Jahr 2024 waren es bisher 1.881 (Stand: 21.05.2024).
Sicher durch die Grillsaison
Auf Geflügel muss deswegen nicht verzichtet werden, es ist allerdings ein guter Grund sich an Hygieneregeln zu halten. Wichtig ist es, möglicherweise belastete Lebensmittel ausreichend zu erhitzen und Kreuzkontamination zu verhindern.
Kreuzkontamination ist der unbeabsichtigte Transfer von Bakterien oder anderen Mikroorganismen von einer Substanz oder einem Objekt auf ein anderes. Im Bereich der Lebensmittelsicherheit bezieht sich dies auf die Übertragung von schädlichen Bakterien, wie eben Campylobacter, meist vom rohen Fleisch auf verzehrfertige Lebensmittel wie Salate, Obst und bereits gekochte Speisen. Das ist der Grund, warum Hühnerfleisch vor der Zubereitung nicht gewaschen werden sollte: Durch das Waschen besteht die Gefahr, dass die Keime weiträumig verteilt werden und letztlich auf anderen Lebensmitteln landen. Die Bakterien werden bei der Zubereitung verlässlich durch die Hitze abgetötet, es ist daher nicht notwendig, das Fleisch zu waschen.
Gute Küchenhygiene beinhaltet zudem, die Hände und Utensilien, sowie Arbeitsflächen nach dem Kontakt mit rohem Fleisch mit heißem Wasser und Seife zu reinigen. Besonders in der Grillsaison ist die Vermeidung von Kreuzkontamination entscheidend, um lebensmittelbedingte Krankheiten zu verhindern.
Eine Besonderheit von Campylobacter ist, dass bereits sehr geringe Keimmengen ausreichen, um eine Infektion beim Menschen auszulösen: Schon 500 Keime genügen, dabei können allein auf einem Gramm Geflügelhaut bis zu 10.000 Keime nachgewiesen werden. Entsprechend sauber sollte mit Geflügel gearbeitet werden.
Hier einige zentrale Tipps zur Hygienepraxis, um das Risiko lebensmittelbedingter Krankheiten zu Hause erheblich zu reduzieren:
- Händewaschen: Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser, bevor und nachdem Sie rohe Lebensmittel berührt haben.
- Separate Utensilien und Flächen: Verwenden Sie separate Schneidebretter und Messer für rohe und verzehrfertige Lebensmittel.
- Richtige Lagerung: Lagern Sie rohe und verzehrfertige Lebensmittel getrennt, vorzugsweise in verschlossenen Behältern.
- Kochtemperaturen: Stellen Sie sicher, dass Geflügel auf die richtige Innentemperatur gebracht wird (mindestens 70 Grad Celsius) - ein Thermometer ist hier hilfreich.
- Sauberkeit: Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig Küchenoberflächen, Grills und Utensilien.
Die Saisonalität lebensmittelbedingter Erkrankungen
Die Zahl der lebensmittelbedingten Infektionen steigt in der warmen Jahreszeit an. Viele Bakterien gedeihen bei hohen Temperaturen besser. Für Campylobacter gilt dies ganz besonders. Bei Temperaturen unter 30 Grad Celsius vermehren sie sich kaum, also auch nicht in Lebensmitteln - im Gegensatz zu Salmonellen. Wenn es richtig warm wird, steigt die bakterielle Belastung bei den Masthühnern an und so steigt auch die Gefahr für Menschen, sich bei belastetem Fleisch eine Durchfallerkrankung einzufangen.
Seltene gefährliche Verläufe
Nicht immer verläuft eine Campylobacteriose harmlos. In seltenen Fällen kann die Erkrankung eine reaktive Arthritis auslösen oder zum Guillain-Barré Syndrom führen.
In Österreich kam zu acht Todesfällen im Jahr 2023.
Meldungen
Am 23.05.2024 ist von der nationalen Referenzzentrale der Jahresbericht 2023 zu Clostridioides (C.) difficile veröffentlicht worden. Bei C. difficile handelt es sich um ein Bakterium, das unter gewissen Umständen den Darmtrakt besiedeln und dort Toxine bilden kann. Dadurch ist es mitverantwortlich für einen Großteil der schweren Durchfallerkrankungen nach Antibiotikagabe. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 136 C. difficile-Proben an die Referenzzentrale geschickt. Über das elektronische Meldesystem wurden zeitgleich 511 schwer verlaufende C. difficile Infektionen (CDI) in Österreich gemeldet, drei CDIs verliefen tödlich.
Der am häufigsten in Österreich im Jahr 2023 isolierte PCR-Ribotyp war der Stamm 014, der bereits in den Jahren 2019 bis 2021 am häufigsten nachgewiesen werden konnte. Der hochvirulente PCR-Ribotyp 027 fand sich bei vier (3,6 %) von 112 Isolaten. Der vor kurzem in Großbritannien entdeckte, ebenfalls als hochvirulent eingestufte Ribotyp 955, konnte in Österreich bisher in keiner der eingesendeten Probe nachgewiesen werden.
Im April hat das wissenschaftliche Netzwerk Cochrane eine Übersichtsarbeit veröffentlicht, in der das Aussetzen von Wolbachia-infizierten Stechmücken als Strategie zur Bekämpfung von Dengue-Fieber untersucht wurde. Die Studie kam zu dem Schluss, dass diese Herangehensweise zur Reduktion von Dengue-Fällen beitragen könne.
Mit dem Wolbachia-Bakterium infizierte Stechmücken sind weitgehend immun gegenüber Dengue- und anderen Viren, womit auch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf den Menschen sinkt. Nachdem die Anwendung von Insektiziden und das Austrocknen der Brutgewässer nur bedingte Auswirkungen auf die Mückendichte hatten und haben, ist ein neuer Ansatz das Freisetzen von künstlich mit Wolbachia infizierten Stechmücken (mehr zu diesem Projekt im AGES-Radar vom 30.11.2023). Eine methodisch hochwertige Studie aus Indonesien ergab, dass Menschen, die in Gebieten leben, in denen mit Wolbachia infizierte Aedes-Mücken freigelassen wurden, ein deutlich geringeres Risiko haben, an Dengue zu erkranken, als Menschen, die in Gebieten leben, in denen solche Mücken nicht freigelassen wurden.
Eine Einschränkung der Evidenz ist, dass bisher nur eine abgeschlossene Studie vorliegt und damit nicht klar ist, ob die Ergebnisse auch für andere Bereiche und Länder gültig sind. Weitere Studien zu diesem Thema sind bereits in Arbeit.
Lässt sich Dengue-Fieber durch das Aussetzen weiterer Stechmücken bekämpfen? | Cochrane Deutschland
Am 5. Mai wurde der Welttag der Handhygiene abgehalten. Dieser findet seit 2009 jährlich unter dem Motto "SAVE LIVES: Clean Your Hands" statt. Die Kampagne richtet sich vorrangig an Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Die Einhaltung von Händehygiene kann Patient:innen, sowie Gesundheitspersonal selbst vor Erregern schützen und stellt eine Schlüsselrolle im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen dar.
World Hand Hygiene Day (who.int)
Fachbegriff Epidemiologie
Der Begriff ist im Zuge der COVID-19-Pandemie häufig verwendet worden und bedeutet einfach übersetzt "Eindämmung". In der Epidemiologie versteht man darunter die Strategie, Räume oder Vorgänge mit einem erhöhten Gefahrenpotenzial frühzeitig abzugrenzen. Das soll verhindern, dass sich eine Infektion vom Ort ihrer Entstehung ausbreiten kann bzw. eine weitere Ausbreitung eindämmen.
Containment kann durch eine Vielzahl an Abgrenzungen und Sperrmaßnahmen versucht werden: Die Kontaktverfolgung und Isolierung von Betroffenen gehört hier ebenso dazu wie Reisebeschränkungen oder auch Riegelungsimpfungen. Dabei wird im Umfeld eines Ausbruchs ungeschützten Personen möglichst rasch eine Impfung angeboten, um die weitere Verbreitung der Infektion zu stoppen.
Über das Radar
Das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erscheint monatlich. Ziel ist es, der interessierten Öffentlichkeit einen raschen Überblick zu aktuellen Infektionskrankheiten in Österreich und der Welt zu geben. Die Krankheiten werden kurz beschrieben, die aktuelle Situation wird geschildert und, wo es sinnvoll und möglich ist, wird das Risiko eingeschätzt. Links führen zu tiefergehenden Informationen. Im "Thema des Monats" wird jeweils ein Aspekt zu Infektionskrankheiten genauer betrachtet.
Wie wird das AGES-Radar für Infektionskrankheiten erstellt?
Wer: Das Radar ist eine Kooperation der AGES-Bereiche "Öffentliche Gesundheit" und Risikokommunikation.
Was: Ausbrüche und Situationsbewertungen von Infektionskrankheiten:
- National: Basierend auf Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS), der Ausbruchsabklärung und regelmäßigen Berichten der AGES und der Referenzlabore
- International: Basierend auf strukturierter Recherche
- Thema der Woche (Jahresplanung)
- Meldungen zu wissenschaftlichen Publikationen und Events
Weitere Quellen:
Akute infektiöse respiratorische Erkrankungen treten in der kalten Jahreszeit vermehrt auf, darunter COVID-19, Influenza und RSV. Diese Erkrankungen werden über verschiedene Systeme beobachtet, wie dem Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ), dem ILI-(Influenza-like-Illness)-Sentinel-System und dem Österreichischen RSV-Netzwerk (ÖRSN). Die Situation in den Krankenhäusern wird über das SARI-(Schwere Akute Respiratorische Erkrankungen)-Dashboard erfasst.
Österreichische Labore schicken SARS-CoV-2-Proben zur Sequenzierung an die AGES. Die Ergebnisse der Sequenzierung werden regelmäßig auf der AGES-Website veröffentlicht.
Für die internationalen Berichte werden Gesundheitsorganisationen (WHO, ECDC, CDC, …) Fachmedien, internationale Presse, Newsletter und Social Media routenmäßig beobachtet.
Für Infektionserkrankungen in Österreich erfolgt die Einschätzung der Situation durch die Expert:innen der AGES, ebenso für internationale Ausbrüche, für die keine Einschätzung von WHO oder ECDC vorliegen.
Disclaimer: Die Themen werden nach redaktionellen Kriterien ausgewählt, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Anregungen und Fragen an: [email protected]
Da die Antwort auf Anfragen ebenfalls zwischen allen Beteiligten (Wissensmanagement, INFE, Risikokommunikation) abgestimmt wird, bitten wir um etwas Geduld. Eine Antwort erfolgt innerhalb einer Woche.
Das nächste AGES-Radar erscheint am 27.06.2024.
Downloads
Aktualisiert: 23.05.2024